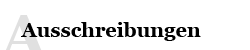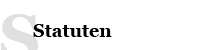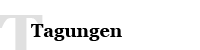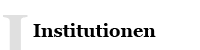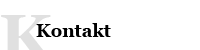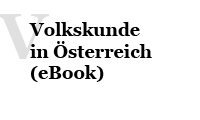Grenze – Konstruktion Realität Narrative
„Die Grenze ist nicht eine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsache, die sich räumlich formt.“
„In dem Erfordernis spezifisch seelischer Funktionen für die einzelnen geschichtlichen Raumgestaltungen spiegelt es sich, dass der Raum überhaupt nur eine Tätigkeit der Seele ist, nur die menschliche Art, an sich unverbundene Sinnesaffektionen zu einheitlichen Anschauungen zu verbinden.“
Georg Simmel, Soziologie des Raums
Das Simmel’sche Diktum zur Staatsgrenze und zur räumlichen Grenze als seelischer Wechselwirkung weist die Behauptung natürlicher, geografischer Determination von Staat endgültig zurück. Dieser in der Literatur zur Grenze immer wieder zitierte Satz, der die soziale Bedingtheit von Staat und Territorium und Staat und Gesellschaft hervorkehrt, offenbart wie kein anderer Satz ganz exemplarisch die Konstruktionsleistung, die eine Grenze darstellt.
Die Tagung „Grenze – Konstruktion Realität Narrative“ geht dieser mentalen wie medialen, dieser sozialkonstruktivistischen wie symbolischen (Re-)Konstruktion der territorialen, (national-)staatlichen Grenze, in Sonderheit der deutsch-deutschen Grenze, in vier thematischen Panels nach:
Das Panel 1, Konstruktion: Eingrenzen – Entgrenzen, bündelt Vorträge zur Grenze als mentaler Konstruktion, zur Theorie der Grenze, zu spezifischen Ein- und Entgrenzungsmechanismen und zu aktuellen Grenzregimen.
Panel 2, Realität: Leben an – leben mit der Grenze, fokussiert aus lokaler Perspektive den Prozess des Entstehens wie der Verwandlung der deutsch-deutschen Grenze sowie aus kultur- und politikgeschichtlicher Sicht das Handeln wichtiger Akteure an der Grenze.
Panel 3, Narrative: Wahrnehmung der Grenze – Erinnerungen an die Grenze, widmet sich dem individuellen wie dem kollektiven Umgang mit der Grenze, den authentischen Erinnerungen und den inszenierten Erinnerungsorten. Begegnungen, Entgegnungen und Auseinandersetzungen mit der Grenze stehen hier im Mittelpunkt.
Panel 4, Narrative: Bilder der Grenze, reflektiert den visuellen Umgang mit der Grenze in den Künsten und Medien. Bild, Fotografie und Film, ihre Visualisierungsstrategien und Inszenierungsleistungen, ihre narrative Funktion im Kulturellen stehen im Fokus dieses Panels.
Die Konferenz wird die erste wissenschaftliche Aktivität des von der Volkswagenstiftung in der Förderlinie „Forschen an Museen“ bewilligten Forschungsprojekts „Die innerdeutsche Grenze als Realität, Narrativ und Element der Erinnerungskultur“ sein.
Programm
Donnerstag, 24. Juni 2010
ab 14.30
Registrierung im Tagungsbüro, Begrüßungskaffee
15.00
Begrüßung und Eröffnung der Tagung (Prof. Dr. Carl-Hans Hauptmeyer und Dr. Thomas Schwark)
Panel 1: Konstruktion: Eingrenzen – Entgrenzen
Moderation: Prof. Dr. Carl-Hans Hauptmeyer
15.30-17.30
Prof. Dr. Andrea Komlosy (Wien) Grenze und Raum Diskussion Dr. Stefan Kaufmann (Freiburg) Grenze und Gesellschaft Prof. Dr. Axel Klausmeier (Berlin) „Iron curtain“ als europäisches Kulturerbe?
Diskussion
17.30-18.00
Pause
Panel 2: Realität: Leben an – leben mit der Grenze
Moderation: Prof. Dr. Astrid M. Eckert
18.00-19.20
Prof. Dr. Detlef Schmiechen-Ackermann (Hannover) Teilung – Gewalt – Durchlässigkeit. Die innerdeutsche Grenze 1945-1989 als Thema und Problem der Zeitgeschichte Gerhard Sälter (Berlin) Grenzpolizisten Diskussion 20.00 Empfang für die Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Historischen Museum, mit Abendessen
Freitag, 25. Juni 2010
Panel 2: Realität: Leben an – leben mit der Grenze (Fortsetzung)
Moderation: Prof. Dr. Astrid M. Eckert
9.00-10.30
Jason Johnson (Northwestern University Evanston, USA) Zur Konstruktion der Grenze in der Region – das Beispiel Moedlareuth Sagi Schaefer (Universität New York, USA) Regionale Identität und Grenze
– das Beispiel Eichsfeld
Diskussion
10.30-11.00
Pause
11.00-13.00
Vorstellung des Forschungsprojektes und Ausstellungsvorhabens „Die innerdeutsche Grenze als Realität, Narrativ und Element der Erinnerungskultur“
Moderation: Prof. Dr. Detlef Schmiechen-Ackermann Vorstellung von ausgewählten Stationen der Ausstellung (durch von der studentischen Projektgruppe erstellte Plakate). Mit Kommentierung durch Fachkolleginnen und -kollegen aus Museen.
Ines Meyerhoff (Hannover) Fotografien und Grenze Dr. Hedwig Wagner (Jena/Hannover) Visualisierung und Inszenierung der deutsch-deutschen Grenze aus Ost und West Diskussion
13.00 Mittagessen
Panel 3: Narrative: Wahrnehmung der Grenze – Erinnerungen an die Grenze
Moderation: Rainer Potratz
14.30-17.30
Prof. Dr. Astrid M. Eckert (Atlanta) Die Grenze und der Tourismus im Westen Dr. Daniela Münkel (Berlin) Leben im Grenzkreis Halberstadt Diskussion Pause Prof. Dr. Axel Kahrs (Lüchow) Grenze und Entgrenzung in der Literatur Dr. Kay Kufeke (Berlin) Grenzmuseen und Erinnerungskultur in Mecklenburg-Vorpommern Diskussion
17.30-18.15
Kleiner Stadtrundgang mit Prof. Dr. Carl-Hans Hauptmeyer 18.30 Abendessen 19.30 Abendvortrag im Historischen Museum Einführung und Moderation: Prof. Dr. Carl-Hans Hauptmeyer Dr. Maren Ullrich (Oldenburg) Die deutsch-deutsche Grenze als Erinnerungslandschaft?
Samstag, 26. Juni 2010
Panel 4: Narrative: Bilder der Grenze
Moderation: Dr. Thomas Schwark
9.00-12.00
Elena Demke (Berlin) Mauerfotografie
Dr. Anke Kuhrmann (Cottbus) Die Bilder der Mauer Diskussion Pause Claus Löser (Berlin) Gegenbilder Prof. Dr. Kay Kirchmann (Erlangen-Nürnberg) Grenzen und Entgrenzungen im Film – Überlegungen zu einer medialen Historiografie
Diskussion
12.30-13.30 Mittagessen
13.30-15.00
Abschlussdiskussion
Moderation: Prof. Dr. Carl-Hans Hauptmeyer Einstieg über eine Podiumsrunde; anschl. Plenumsdiskussion; Prof. Dr. Astrid M. Eckert (Atlanta) Prof. Dr. Michele Barricelli (Hannover) Dr. Hans-Hermann Hertle (Potsdam) Prof. Dr. Gerhard Paul (Flensburg)