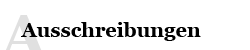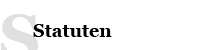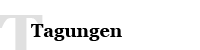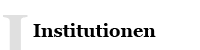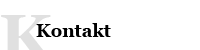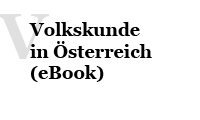dgv-Hochschultagung 2012 in Innsbruck (Termin: 28.-30. September 2012)
Äußerungen.
Die Oberfläche als Gegenstand und Perspektive der Europäischen Ethnologie
Die Auseinandersetzung mit dem Begriff und Phänomen der Oberfläche soll bei der dgv-Hochschultagung 2012 in Innsbruck in zweifacher Hinsicht erfolgen: in gegenständlicher und in programmatisch-prinzipieller.
Oberfläche haptisch
Ein Spezifikum volkskundlich-ethnologischen Fragens und Forschens ist das Interesse für die materielle Kultur und ihre soziale und kulturelle Bedeutung. Diese Bedeutung konstituiert sich in der Interaktion zwischen Mensch und Ding und damit in besonderem Maße an der Schnittstelle, nämlich der Oberfläche. Die Oberfläche wird dabei nicht nur, aber auch verstanden als die äußere Schicht eines Objektes, welche dieses von der Umgebung abgrenzt. Zu fragen ist daher zum einen nach der Beschaffenheit und dem Aussehen von Oberflächen. Die Aufmerksamkeit gilt hier den Übergangszonen, den Konturen und Kanten, den Mehrdeutigkeiten und Widerhaken. Zum anderen ist die Oberfläche auch als Ort der Interaktion, als Handlungs- und Deutungsraum zu verstehen. Das methodische Interesse gilt vor allem der Oberfläche als Grenze zwischen den Menschen und ihren kulturellen Objektivationen, die Oberflächen reflektieren damit immer auch das menschliche Interesse, das sich auf sie richtet.
Oberfläche metaphorisch
Doch der Begriff der Oberfläche lässt sich noch in einem weiteren Sinn als kulturwissenschaftlich relevant begreifen. Es ließe sich argumentieren, dass Kultur selbst ein Oberflächenphänomen bezeichnet. In Äußerungen, Hervorbringungen und Formen der Kommunikation stellt Kultur gerade das dar, was an die Oberfläche, darüber hinaus und damit in den Bereich der Wahrnehmbarkeit gelangt. Das ethnografische Interesse, verstanden als empirisch fundierte Auseinandersetzung mit Kultur, geht stets von Phänomenen und damit von Objektivationen aus und erschließt ihre Bedeutung in der Interpretation.
Unter die Oberfläche reichen die volkskundlich-ethnologischen Zugänge zunächst nicht, die Oberfläche ist damit die Grenze unserer methodischen Zugriffe. Das Bedürfnis und der Bedarf, von den Phänomenen ausgehend in die Tiefe zu gelangen ist jedoch ebenso verbreitet wie legitim. Dabei stellt sich allerdings die drängende Frage nach den Grenzen zwischen Phänomen, Interpretation und Spekulation.
Daraus ergeben sich methodische, methodologische und forschungsethische Probleme: Welche Reichweite haben Schlüsse auf dieser Basis? Wenn Materialien und Methoden die Reichweite der Volkskunde bzw. ihrer Erklärungsmöglichkeiten bestimmen, wie weit kann das Fach selbst in die Tiefe gehen und wo ist anderen das Feld zu überlassen? Wo erlauben Oberflächen mit ihrer Leitfähigkeit Rückschlüsse auf Inneres? Wie kann das Offensichtliche zum gewissermaßen Verborgenen führen? Wo deuten Vibrationen, Erschütterungen, Verwerfungen oder Brüche auf Vorgänge unter der Oberfläche hin? Und bei wem verbleibt schließlich die Deutungshoheit über die Äußerungen und Objektivationen und darüber, was sich – vermutlich – unter der Oberfläche tut?
Es soll also um die Europäische Ethnologie als eine oberflächige, keineswegs oberflächliche Disziplin gehen. Damit bietet die dgv-Hochschultagung einen Rahmen für Reflexionen zum Fachverständnis wie zu den Zugängen der Disziplin Volkskunde, wir erhoffen uns sowohl exemplarische als auch grundlegende Beiträge zur Bedeutung der Oberfläche für Fach und Forschung.
Interessierte werden gebeten, Abstracts von maximal 2.000 Zeichen bis zum 1. Februar 2012 an folgende Adresse zu senden:
Universität Innsbruck
Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie
Fach Europäische Ethnologie; Stichwort: Hochschultagung
z.Hd. Frau Carina Osl
Innrain 52
A-6020 Innsbruck
Oder per E-mail an:
europ-ethnologie[at]uibk.ac.at