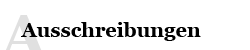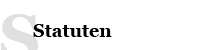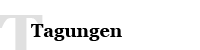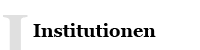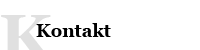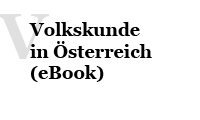LVR-Fachbereich Kultur / LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum (Deutsches Schiffahrtsmuseum Bremerhaven / Museumsverband für Niedersachsen und Bremen e.V.), Bremerhaven 15.12.2010, Deutsches Schiffahrtsmuseum Bremerhaven
Deadline: 15.12.2010
CALL FOR PAPER – MAI-Tagung 2011
Auch in diesem Jahr wird sich die MAI-Tagung mit neuen und innovativen Entwicklungen im Bereich internetbasierter Museumspräsentationen und -dienste beschäftigen und aktuelle Informationen und Sachstandsberichte über museale Internetprojekte aus dem In- und Ausland vorstellen. Anhand von Fachvorträgen und Praxisbeispielen soll veranschaulicht werden, welche Möglichkeiten Museen haben, auf bestehender Medienkompetenz und -ausstattung aufzusetzen, um kulturelle Inhalte via Internet an ihr Publikum zu vermitteln oder untereinander zu kommunizieren und kooperieren.
TERMIN: 26./27. Mai 2011
TAGUNGSORT: Deutsches Schiffahrtsmuseum, Hans-Scharoun-Platz 1, D-27568 Bremerhaven
TEILNEHMERZAHL: Tagung: max. 80 Personen
Workshops: je max. 20 Personen
————————————————————————
THEMEN
Wünschenswerte Themenbereiche für die MAI-Tagung 2011 sind:
- Neue Projekte, Initiativen und Internetpräsenzen (von z.B. Museen, Archiven, Bibliotheken, Universitäten, Fachhochschulen)
- Digitale Sammlungsrepräsentationen online (z.B. Datenbanken, Content-Management-Systeme, Guided Tours)
- Strategien zum Suchen und Gefunden werden im Internet (z.B. Portale, Suchmaschinen, Suchstrategien)
- Projekte an der Schnittstelle Museen und Schule (z.B. Initiativen, Partnerschaften)
- Anwendungen zu barrierefreiem Internet im kulturellen Bereich (z.B. Projekte, Tools, Qualitätsmanagement)
- Applikationen und Projekte zur medial-musealen Vermittlungsarbeit (Museumspädagogik, eLearning, Blended-Learning)
- Online-Marketing- und Kommunikationsmöglichkeiten (z.B. RSS, Newsletter, Banner-Werbung)
- Neue technische und konzeptionelle Umsetzungen im Bereich „Web 2.0“ und SocialMedia (z.B. Facebook, Twitter, Wikis, Blogs, Social-Bookmarks, Tagging)
- Vermarktungsstrategien für Museen (z.B. Online-Shops, Ticketing, eCommerce)
- Mobile-Computing und Mobile-Phones und deren Einsatz im musealen/kulturellen Sektor (z.B. Apps, Multimedia- und Audio-Guides, PDA, Handy-Führungen, georeferenzierte Angebote, Downloads)
- Screen-Design und Usability für kulturelle WebSites (z.B. Studien, Best-practice)
- Online-Games, Online-Broadcasting, Online-Publishing (z.B. Theorien, praktische Beispiele)
FORMATE
Die Einreichungen können sich auf Vorträge, Kurzvorträge, ShortCuts, Workshops und auf „Pecha Kucha“* beziehen.
Die Vorträge sollten 30 Minuten nicht überschreiten (plus 15 min Diskussion). Die Kurzvorträge sollten 20 Minuten nicht überschreiten (plus 10 min Diskussion). Darüber hinaus sind auch kürzere Beiträge in Form von Fallbeispielen (ShortCuts) möglich. Die Workshops haben eine Dauer von 3 bis 4 Stunden und finden üblicherweise am Nachmittag des zweiten Veranstaltungstages statt.
* „Pecha Kucha“ – ist eine Vortragstechnik mit Bildprojektion, welche festgelegten Formen zu entsprechen hat. Die Anzahl der Bilder ist dabei mit 20 Stück ebenso festgelegt wie die 20-sekündige Dauer der Projektionszeit pro Bild. Die Gesamtdauer des Vortrags beträgt somit 6 Minuten und 40 Sekunden.
ABSTRACTS
Senden Sie bitte einen Abstract im Umfang von max. einer DIN A4-Seite und gerne auch weitere Informationen zu Ihrem Themenbeitrag (sowie zusätzlich die vollständigen Adressdaten und einige biographische Angaben) an folgende e-Mail-Adresse: mailto:mai-tagung@lvr.de
Die Referentinnen und Referenten werden gebeten, im Nachgang der Veranstaltung ein (Kurz-) Manuskript oder eine aufbereitete Präsentationsunterlage zur Verfügung zu stellen, welches als downloadbare PDF-Datei auf die Internetseite der Tagung eingestellt wird.
TERMINE
- Einreichungen werden bis zum 15. Dezember 2010 entgegengenommen
- Mitteilung über die Aufnahme der Einreichungen erfolgt bis Ende Januar 2011
KONTAKT
Thilo Martini
Landschaftverband Rheinland
LVR-Fachbereich Kultur
Ottoplatz 2, 50679 Köln
Tel.: +49 (0)221 / 809 – 21 43
Fax: +49 (0)221 / 82 84 – 19 25
mailto:mai-tagung[at]lvr.de
WEITERE INFORMATIONEN
VERANSTALTER
Das LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum Brauweiler veranstaltet gemeinsam mit dem LVR-Fachbereich Kultur und in Zusammenarbeit mit wechselnden Partnern sowie an wechselnden Orten alljährlich im Mai eine Fachtagung zum Themengebiet „Museen und Internet“.
Kooperationspartner der diesjährigen MAI-Tagung sind das Deutsche Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven und der Museumsverband für Niedersachsen und Bremen e.V.
ZIELE
Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den für die Museen maßgebenden Entwicklungen des WWW bekannt zu machen, ihnen Impulse und Orientierung für die eigene Arbeit zu geben und sie zur Mitgestaltung neuer Strukturen zu ermutigen. Wichtige thematische Aspekte sind dabei die besonderen Präsentations-, Werbe-, Marketing- und Kommunikationsmöglichkeiten des Internets.
Die Tagung versteht sich darüber hinaus auch ausdrücklich als ein Gesprächs-, Austausch- und Kontaktforum.
ADRESSATEN
Angesprochen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Museen, Ausstellungshäusern und anderen Kulturdienstleistern und -administrationen sowie Archiven und Bibliotheken, die im Rahmen ihrer Tätigkeit bereits praktische Erfahrungen mit Internet-Auftritt und -Präsenz gewonnen haben und das Medium auch weiterhin gezielt und nutzbringend einsetzen wollen oder als Web-Master oder Redakteur für den Internetauftritt der jeweiligen Institution verantwortlich zeichnen.
INTERNETADRESSE
Weitere Informationen zur Tagung werden kontinuierlich im Internet bereitgestellt. Eine Dokumentation der vorausgegangenen Tagungen finden Sie ebenfalls unter: http://www.mai-tagung.de
NEWSLETTER
Wenn Sie jederzeit aktuell über die Tagung informiert sein möchten, können Sie sich auch für den Newsletter der MAI-Tagung – das sog. „MAI-Ling“ – anmelden. Diese Anmeldung finden Sie unter: http://www.mai-tagung.de/MAI-Ling