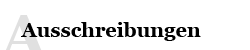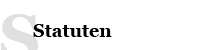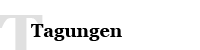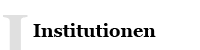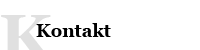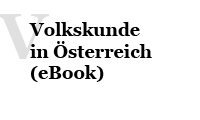CALL FOR PAPERS zum 38. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde
Tübingen, 21. – 24. September 2011, Einsendeschluss: 21.08.2010
Der 38. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde wird auf Einladung des Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische Kulturwissenschaft der Eberhard Karls Universität Tübingen vom 21. bis 24. September 2011 in Tübingen stattfinden. Vorstand und Hauptausschuss haben sich auf folgendes Thema geeinigt.
Kultur_Kultur
Denken, Forschen, Darstellen
Die Mitglieder der dgv und alle weiteren Interessierten sind herzlich eingeladen, den Kongress aktiv mit zu gestalten und Beitragsvorschläge für Vorträge und Panels einzureichen. Insbesondere die Kommissionen der dgv werden gebeten, Panels vorzuschlagen.
Zum Thema:
Kultur ist nicht nur seit nunmehr vier Jahrzehnten die zentrale Kategorie der Volkskunde und ihrer Fortentwicklungen, Kultur ist – ungeachtet aller Problematik – nach wie vor eine der wirkmächtigsten Ordnungsvorstellungen der Moderne. Als Konzept der Selbstauslegung hatte Kultur zu keiner Zeit eine ähnliche Reichweite und Anziehungskraft besessen wie heute, zugleich beschreibt sie ein Feld wachsender Ökonomien, ist weltweit Gegenstand politischen Handelns und nicht zuletzt Schlüsselbegriff und Fluchtpunkt einer Reihe von sich zusehends als Kulturwissenschaften verstehenden Fächern.
Seit dem von Tübingen ausgehenden „Abschied vom Volksleben“ nimmt der um die alltägliche und lebensweltliche Dimension erweiterte Kulturbegriff eine zentrale Stellung im disziplinären Selbstverständnis des Faches ein. Die Wendung hin zu einer mehr prozessualen und relationalen Vorstellung von Kultur, wie sie in den letzten Jahren verstärkt vollzogen wurde, betrifft den Kern volkskundlicher Kulturwissenschaft und trug nicht zuletzt zu ihrem disziplinären Fortbestand bei. Vor diesem Hintergrund bildet die momentan zu beobachtende Konjunktur – bei gleichzeitiger Krise des Kulturkonzepts – eine besondere Herausforderung: writing again(st)/for culture?
Der Tübinger Kongress will dazu einladen, die kulturale Wende einer umsichtigen Evaluierung zu unterziehen und zu fragen, wie sich eine Kulturwissenschaft rüsten sollte, die für sich sowohl eine selbstkritische Zuständigkeit reklamieren möchte als auch auf die veränderten Bedingungen für ein Verstehen der kulturalen Dimension der sozialen Welt zu reagieren hat. Es geht dabei naturgemäß weder allein um Theorien und Methoden noch um eine Wiederholung von Diskussionen um Repräsentationen von Kultur oder die notwendigen Differenzierungen einer desavouierten machtvollen Konstruktion. Der Kongress soll vielmehr das Verhältnis des Faches zu seinem Gegenstand prüfen und neu begründen helfen; er soll dazu anleiten, populäre Denkweisen in Geschichte und Gegenwart ebenso in den Blick zu nehmen, wie die Probleme und Perspektiven der Kulturforschung in einer sich zusehends interdisziplinär organisierenden Wissenschaftslandschaft. Dafür will der Kongress auch mit anderen Fächern, ihren Denk- und Arbeitsweisen, ins Gespräch kommen, nicht zuletzt mit neueren Forschungsrichtungen, in denen Kultur anders konnotiert oder bewusst nicht zentral gestellt ist.
Die Perspektiven, die den Beiträgen und Diskussionen des Kongresses gegeben werden könnten, sind mit Absicht nicht kategorial gedacht. Sie mögen als Anregungen genommen werden, Fragen nach Ideen, nach Empirie und Praxis nicht zu separieren, sondern in ihren wechselseitigen Verhältnissen zu thematisieren.
Kultur, denken: Eine ‚theorielose‘ Rede über Kultur gibt es nicht. Zu fragen wäre daher nach den wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Konzepten von Kultur in ihrer historischen und sozialen Bedingtheit, nach Gleichzeitigkeiten der Denkweisen, nach Konflikten und Funktionalisierungen. Dabei sollte sich die Nachfrage nicht auf die Diskussion der Ideen selbst beschränken, sondern den Blick öffnen für ihre konkreten Anwendungen, gesellschaftspolitischen und ökonomischen Implikationen.
Kultur, forschen: Der Anspruch, Kultur empirisch zu erfassen und zu analysieren, geht einher mit der Aufmerksamkeit für ihre Artikulationsformen und Bedeutungen. Mit den gegenwärtig zu beobachtenden Dynamisierungsschüben kulturellen Wandels sind insofern besondere Herausforderungen an das Fach verbunden, als sie Neujustierungen in seinem methodischen und theoretischen Instrumentarium erfordern. Vor diesem Hintergrund ist eine kritische und mit einem historischen Blick auf das Kulturverständnis des Faches vorgehende Diskussion um die Tragfähigkeit neuerer Zugangsweisen gefragt. Nicht zuletzt geht es um eine Auswertung der Konsequenzen der Erweiterungen und Differenzierungen des kulturwissenschaftlichen Theorie- und Methodenspektrums.
Kultur, darstellen: Über Kultur wird nicht nur sinngenerierend geforscht und geschrieben, sondern Kultur ist zugleich ein Feld vielfältiger Zeigeweisen und Anwendungsfelder. Das von der volkskundlichen Kulturwissenschaft produzierte Wissen ist zugleich ein machtvoller Faktor in den sinnstiftenden Praktiken und Diskursen der lebensweltlichen Akteure. Zu diskutieren wären die virulenten Fragen nach der historischen und gegenwärtigen Stellung kulturwissenschaftlichen Wissens in der Öffentlichkeit und in Beziehung zu den wiederum von Kultur durchwirkten strukturellen Bedingungen. Ausgangspunkt dafür könnte die Frage nach seinen Vermittlungsformen und Wechselwirkungen mit populären Wissensbeständen, schließlich nach seinen Aneignungs- und Umschreibungsprozessen im lebensweltlichen Alltag sein. Eine besondere Aufmerksamkeit sollte dabei denjenigen Regimes, Institutionen und Medien zukommen, die sich am Schnittpunkt dieser beiden, in einem unauflöslichen Verweisungsverhältnis zueinander stehenden Felder der kulturellen Wissensproduktion befinden.
Neben diesen mehr grundsätzlichen Blickrichtungen könnten im Konkreten folgende Aspekte und Fragestellungen bei der Anmeldung von Beiträgen besondere Berücksichtigung finden:
- Kulturanalyse: Wo ist der Ort der Kultur im theoretischen Horizont des „Vielnamenfaches“ Volkskunde im engeren bzw. der Geistes- und Sozialwissenschaften im weiteren Sinne, welche leitenden Kategorien und Erkenntnisinteressen werden dabei vom jeweiligen Verständnis von „Kultur“ integriert und differenziert?
- Kultur vs. Kulturen: Welches sind die Konsequenzen der Pluralisierung des Kulturbegriffs, wie lassen sich sowohl Essentialisierungen als auch der Verlust der Analyseschärfe in der Fragmentierung umgehen und wie können Konzepte des Fluiden, Sektionalen/Relationalen und Situativen anwendbar gemacht werden?
- Empirien des Kulturalen: Welches sind die zentralen Fragen und Zugangsweisen, welches die kognitiven und epistemischen Spezifika einer auf das Verstehen von Kultur im alltäglichen Horizont zielenden Disziplin, wie lassen sich populare Kulturen im subjektiven Modus, in der Perspektive von Erfahrung und Praxis erfassen?
- Pluralisierung der Kulturwissenschaften: Was bedeutet die Konjunktur des Kulturbegriffs in den angrenzenden Disziplinen für Stellung und Selbstverständnis der volkskundlich-kulturwissenschaftlichen Fachrichtungen, wie reagiert das Fach auf die weltweite Reorganisation der Wissenschaftslandschaft und damit der akademischen und öffentlichen Wahrnehmung?
- Kulturtechniken der Volkskunde: Welche Einsichten ermöglicht ein konsequent kulturwissenschaftlich informierter Blick auf historische und gegenwärtige Wissenspraktiken und Darstellungsweisen im Feld der Kultur, was sind die sozialen Wirkweisen der Institutionen, Dinge und Medien des Kulturwissens?
- Kultur und Kulturalismus: Wie bringt sich ein Fach in Position, dessen zentrale Kategorie ebenso fragwürdig wie unverzichtbar ist, welches sind die Voraussetzungen einer reflektierten Wissensproduktion und –applikation unter den Bedingungen gesteigerter Nachfrage, aber auch gestiegenen Wettbewerbs?
- Kultur als soziale Ressource: Welche Rolle spielt die metakulturelle Dimension in der sozialen Praxis historischer und gegenwärtiger Gesellschaften, wie argumentieren Konzepte wie kulturelles Erbe und kulturelles Eigentum und wie verändern sie lebensweltliche Ordnungen und Orientierungen?
- Kultur als Arbeitsfeld: Wie sind die Kulturwissenschaften – und im Besonderen die Studierenden und Absolventinnen und Absolventen der Volkskunde/Europäischen Ethnologie – für die Herausforderungen der Praxis gerüstet, welche Anforderungen stellen sich durch die weltweite Ökonomisierung und Professionalisierung des Kulturbetriebs?
Wie in der Vergangenheit soll auch der Tübinger Kongress in Form von Plenar- und Sektionsvorträgen sowie durch Panels gestaltet werden. Panels erhalten mit zwei Stunden den Umfang einer Sektion. Die Leiterin/ der Leiter eines Panels konzipiert das Thema und schlägt dieses der dgv in Form eines Abstracts vor. Ebenso werden die Referentinnen und Referenten (unter Beifügung jeweils eines Abstracts ihrer Vorträge) benannt. Die konkrete Gestaltung des Panels (Form der Einführung, Zahl der Vorträge, Kommentare) obliegt – unter Einhaltung der zeitlichen Vorgaben – den jeweiligen Organisatorinnen bzw. Organisatoren der Panels. Die Panels können auch über die dgv-Informationen und die im Fach üblichen Mailing-Listen ausgeschrieben werden. Ausdrücklich soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass alle in der dgv vertretenen Gruppen eingeladen sind Panels zu organisieren und dass gerade die Panels zur interdisziplinären Zusammenarbeit mit thematischen Schwerpunkten genutzt werden können.
Daneben soll es wie auf den letzten Kongressen Sektionen für die Erörterung von Museumsfragen und Ausstellungsprojekten, sowie für Ma(gi)sterkandidatinnen und ‑kandidaten und für studentische Projekte geben, die nicht zwingend mit dem Kongressthema in Verbindung stehen müssen. Auch hierfür sind Abstracts erbeten, die sich an den unten genannten Vorgaben orientieren.
Bitte beachten Sie bei der Einreichung Ihrer Abstracts folgende Anforderungen:
- Die Abstracts sollten außer einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung Angaben über die Fragestellung und die empirische Basis enthalten bzw. Auskunft über den Kontext geben, in dem die Arbeit entsteht, ggf. mit Angaben zu bereits vorliegenden Veröffentlichungen, den Stand der Arbeit bzw. erste Ergebnisse.
- Es sollte sich selbstverständlich um neue und unveröffentlichte Forschungsbeiträge handeln.
- Beiträge können auf Deutsch oder Englisch gehalten werden.
- Die Abstracts sollten Angaben über den beruflichen Werdegang und die derzeitige Tätigkeit der Bewerberin/ des Bewerbers enthalten.
- Bitte geben sie gültige Post- und Emailadressen an, bei Panelvorschlägen sowohl der verantwortlichen Organisatoren, als auch aller Beitragenden.
- Die einzelnen Abstracts sollten eine DIN A4-Seite nicht überschreiten (max. 2.400 Zeichen inkl. Leerzeichen).
- Für die Einreichung per Email benutzen Sie bitte .rtf oder .doc-Format. Bitte fassen Sie alle Teile zu einem Dokument zusammen und benennen sie die Datei mit „Ihrem Namen_Proposal_dgvtuebingen2010.doc“, bzw. „Name des/der PanelleiterIn_Panelvorschlag_dgvtuebingen2010.rtf“.
- Bitte reichen Sie die Proposals bis zum 21.08. 2010 per Email und Post bei der dgv ein.
Einsendungen sind zu richten an:
Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde
Stichwort: 38. dgv-Kongress
Eberhard Karls Universität Tübingen
Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft
Burgsteige 11 (Schloss)
72070 Tübingen
Email: geschaeftsstelle[at]d-g-v.de
Um das Auswahlverfahren zu erleichtern und transparent zu gestalten, werden alle Einreichenden dringend ersucht, diesen Vorgaben zu folgen. Vorstand und Hauptausschuss werden auf ihrer gemeinsamen Sitzung am 23./24. September 2010 das endgültige Programm festlegen und im Frühjahr 2011 veröffentlichen.