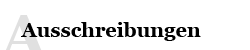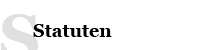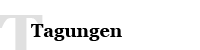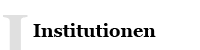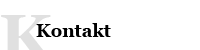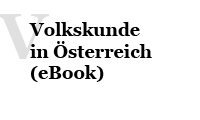CALL FOR PAPERS
5. Studentisches Symposium der Europäischen Ethnologie in Bamberg am 21.1.2011
Neue Helden braucht das Land!? – von Achill bis Guttenberg
Nach langer Abwesenheit sind Helden und Heldinnen in den letzten Jahren wieder zu einem Thema geworden, das – explizit wie implizit – immer wieder in (massen-)medialen wie auch wissenschaftlichen Diskursen aufgegriffen wird. Klassischen Helden, wie wir sie aus Sagen und Erzählungen kennen, stehen dabei zunehmend Helden des Alltags und Antihelden gegenüber.
Zwischen Fiktion und Realität bewegen sich Helden der Öffentlichkeit, Menschen, die von medialen Diskursen überhöht und als überlebensgroß dargestellt werden. Zu ihnen zählen politische wie wirtschaftliche Helden, Helden im Krieg oder Vorbilder an Hilfsbereitschaft oder Zivilcourage. Ihnen allen ist gemein, dass sie als Personen und nicht in ihrer bloßen Funktion als Sprecher oder Mitglieder von Organisationen und Interessengruppen ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden.
Was braucht es, um zum Helden zu werden? Wie werden Helden inszeniert? Warum gibt es sie? Warum machen sich politische Diskussionen so oft an zu Helden stilisierten Persönlichkeiten fest, statt an Sachfragen, Parteien, Strukturen und Funktionen? Können Helden mit Gruppen, Nationen oder spezifischen Berufsgruppen identifiziert werden? Welche Folgen hat der Heldenkult und wo liegt der Unterschied zwischen Held und Antiheld?
Auch Helden des Alltags existieren nicht unabhängig von übergeordneten Diskursen. Zumeist handelt es sich dabei um Menschen, die durch Lebensstil, besonderes Verhalten oder auch nur einen einzigen „heldenhaften“ Moment die Grenzen des Normalen überschreiten und so zu Vorbildern – oder auch deren negativ besetzten Kontrastbildern – werden. Was macht Menschen zu Helden? Wie erfahren wir von ihnen? Stecken hinter den Helden des Alltags wirkliche Menschen und ihre Schicksale, oder handelt es sich letzten Endes doch um generalisierte Vorbilder und Stereotype, die lediglich dem Ziel der moralischen Belehrung dienen?
Eine letzte Gruppe bilden fiktive Helden. Jene bestehen nicht nur aus den klassischen Helden der Sagen und Mythen, sondern auch aus „modernen“ Helden in Comics, Romanen und Spielfilmen. Dienen Superhelden und ihre Gegner uns als Vorbilder im Leben – oder sind sie lediglich Symptom einer Flucht aus einer Realität, in der „Heldentum“ nicht (mehr) möglich ist?
Welche Wechselwirkungen gibt es zwischen Alltag und Fiktion? Wann und warum trat der „ganz normale Mensch“ neben die Halbgötter der antiken Sagen? Waren vielleicht schon die Heiligen und Märtyrer Vorlagen für das Motiv des „heldenhaften Normalbürgers“ oder gibt es den Menschen jenseits des „Normalen“ gar nicht?
Last but not least:
Welche besondere Rolle hat der Antiheld? Ist er nur Gegenstück zum Helden, oder geht seine Bedeutung weit darüber hinaus? Ist der Antiheld womöglich sogar Voraussetzung dafür, dass es Helden geben kann?
Das Studentische Symposium der Europäischen Ethnologie findet am 21.1.2011 in Bamberg statt. Es soll Studierenden und Promovierenden aller Fächer eine Plattform bieten, um sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen. Wir nehmen Vorträge zu Bacchelor- und Masterarbeiten, Hauptseminarsreferaten und Promotionsthemen, oder einfach ausgearbeitete Vorträge zu eigenen Themen und Interessengebieten an.
Bitte schickt kurze Abstracts eurer Vorträge bis zum 31.12.2011 an: ak.euroethno[at]uni-bamberg.de