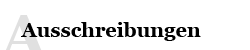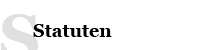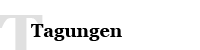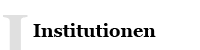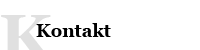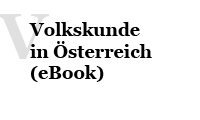Call for Papers: Vergleichen, bewerten, prämieren: Dimensionen des Kompetitiven.
Interdisziplinäre Tagung, 8.-10. Dezember 2011, am Seminar für Europäische Ethnologie/Volkskunde der Christian-Albrechts-Universität Kiel
Wettbewerbe durchdringen viele unserer Lebensbereiche. Als Praxisformen – oder cultural performances – sind Wettbewerbe in unsere Biographien eingeflochten, sie begegnen uns in großen medialen Inszenierungen, sind grundlegende Organisationsformen des sportlichen Wettkampfs und bilden wirkungsvolle Instrumente einer wirtschaftlichen Ideologie. Wettbewerbe messen Leistung, indem sie nach quantitativen oder qualitativen Kriterien Ranglisten erstellen, die die Teilnehmer/innen – mitunter binnendifferenziert – in Gewinner und Verlierer einteilen. Immer wenn qualitative Kriterien zur Anwendung kommen, unterwerfen sich Akteure dabei machtvollen Prozessen der Aushandlung: Denn wer bestimmt mit welchen Argumenten, dass ein Hobbysänger zu Deutschlands Superstar wird, dass die Forschungsprojekte einer Hochschule exzellent sind oder dass der Entwurf für ein städtisches Gebäude architektonisch wie ästhetisch überzeugend ist?
Die Omnipräsenz von Wettbewerben und Wettkämpfen – mit Simmel der „Konkurrenz“, mit Huizinga der „Agonalität“ – ist inzwischen nicht nur von den Kulturwissenschaften erkannt worden, sie erfährt aus verschiedenen Perspektiven Kritik: „Es zeigt sich, dass Wettkämpfe ein großartiges Vehikel sind, um Menschen zu kollektiv irrationalem Verhalten anzustiften“ (Binswanger 2010: 58) argumentierte etwa der Schweizer Volkswirtschaftler Mathias Binswanger und setzte dem von ihm konstatierten „Wettbewerbsenthusiasmus“ (ebd.: 45) eine kritische, ökonomische Sichtung entgegen. Künstlich würden im Bildungs- und Gesundheitswesen, in der Wissenschaft oder im öffentlichen Sektor Wettbewerbe installiert, um damit eine vermeintlich höhere Effizienz zu provozieren. Anders gelagert sind etwa pädagogische Reflektionen dazu, wie Wettbewerbe „als externe Unterstützungs- und Anreizsysteme“ (Beutel und Marwege 2007: 205) im schulischen Unterricht gezielt eingesetzt werden können. Diese beiden Pole einer wissenschaftlichen Einschätzung sowie die lebensweltliche Breite des Phänomens möchte die interdisziplinäre Tagung zum Anlass nehmen, sich mit den komplexen Dimensionen des Kompetitiven in Geschichte und Gegenwart auseinanderzusetzen.
Interdisziplinäre Beiträge können folgende thematische Schwerpunkte diskutieren und dabei Akteure, Praxen und Diskurse von Wettbewerben fokussieren. Dabei sind theoretische oder empirische Beiträge (auch Qualifikationsarbeiten), die in historischer oder synchroner Perspektive grundiert sein können, gleichermaßen willkommen:
1. Performanzen des Kompetitiven
– Wie lassen sich Wettbewerbe als Praxisformen analytisch fassen?
– Nach welchen performativen Mustern sind Wettbewerbe organisiert?
– Inwiefern zitieren, kopieren, parodieren Wettbewerbe?
– Lassen sich Praxen des Kompetitiven differenzieren?
– Welche performativen Strategien entwickeln Akteure, um sich und ihre Leistungen zu inszenieren oder um Wettbewerbslogiken zu unterwandern?
2. Diskurse einer umstrittenen Praxis
– Welche Akteure bewerten und nutzen Wettbewerbe in welcher Form?
– Welche wissenschaftlichen Positionen befassen sich auf welche Weise mit kompetitiven Mustern?
– Welche Wirkungen werden Wettbewerben diskursiv eingeschrieben?
– Wie und aus welcher Perspektive formieren sich Argumente einer Wettbewerbskritik?
3. Machtvolle Hierarchisierungen
– Wie und mit welchen Zielen werden Bewertungskriterien ausgehandelt?
– Inwiefern und mit welchen kulturellen Logiken formatieren Wettbewerbe ihre Teilnehmer/innen?
– Wie manifestieren sich in Wettbewerben Macht und Hierarchie?
Beiträge im Umfang von maximal 350 Wörtern sind mit einer kurzen biografischen Notiz bis zum 09.03.2011 einzureichen an Markus Tauschek: tauschek [at]volkskunde.uni-kiel.de.
Vorträge sollten für eine Dauer von 20-30 Minuten konzipiert sein. Eine Publikation der Ergebnisse ist vorgesehen. Wir bemühen uns derzeit um eine Finanzierung der Tagung.
Kontakt:
Prof. Dr. Markus Tauschek
Juniorprofessur Europäische Ethnologie/Volkskunde
Seminar für Europäische Ethnologie/Volkskunde
Christian-Albrechts-Universität Kiel
Olshausenstr. 40
24098 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 880 3223
Fax: +49 (0) 431 880 1705
http://www.europaeische-ethnologie-volkskunde.uni-kiel.de/